.
Kaschubisches Weihnachtslied
von Werner Bergengruen
|
Originaltext - gesprochen von Werner Bergengruen |
|
Als Lied - in einer modernen Interpretation |
Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,
wärst du,
Kindchen, doch bei uns geboren!
Sieh, du
hättest nicht auf Heu gelegen,
wärst auf
Daunen weich gebettet worden.
Nimmer wärst
du in den Stall gekommen,
dicht am Ofen
stünde warm dein Bettchen,
der Herr
Pfarrer käme selbst gelaufen,
dich und deine
Mutter zu verehren.
Kindchen, wie
wir dich gekleidet hätten!
Müsstest eine
Schaffellmütze tragen,
blauen Mantel
von kaschubischem Tuche,
pelzgefüttert
und mit Bänderschleifen.
Hätten dir den
eig’nen Gurt gegeben,
rote Schuhchen
für die kleinen Füsse,
fest und blank
mit Nägelchen beschlagen!
Kindchen, wie
wir dich gekleidet hätten!
Kindchen, wie
wir dich gefüttert hätten,
früh am Morgen
weisses Brot mit Honig,
frische
Butter, wunderweiches Schmorfleisch,
mittags
Gerstengrütze, gelbe Tunke,
Gänsefleisch
und Kuttelfleck mit Ingver,
fette Wurst
und goldnen Eierkuchen,
Krug um Krug
das starke Bier aus Putzig!
Kindchen, wie wir
dich gefüttert hätten!
Und wie wir
das Herz dir schenken wollten!
Sieh, wir
wären alle fromm geworden,
alle Knie
würden sich dir beugen,
alle Füsse
Himmelswege gehen.
Niemals würde
eine Scheune brennen,
sonntags nie
ein trunkner Schädel bluten, -
wärst du,
Kindchen, im Kaschubenlande,
wärst du,
Kindchen, doch bei uns geboren!
Versuch einer Vertonung;
Melodie nach Franz Motzer:
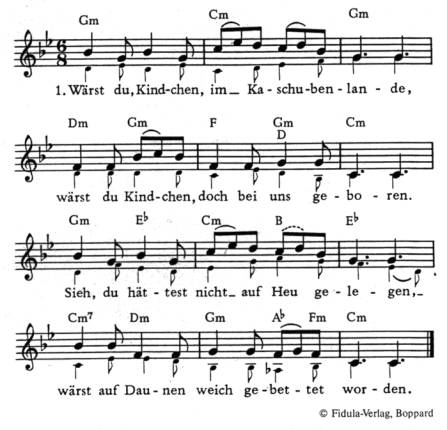
Das „Kaschubische Weihnachtslied“ von Werner Bergengruen
entstand im Jahre 1927. Es erschien in einer Anzahl von Zeitungen und
Zeitschriften, die heute schwer festzustellen sind. Bergengruen hat es dann in
eine Gedichtsammlung aufgenommen, die 1938 erschienen ist. Es wäre möglich,
dass der Dichter dieses Gedicht direkt aus dem Kaschubischen übertragen hätte,
da er einiger slawischer Sprachen sehr wohl mächtig war; es hat jedoch eine
andere Grundlage: Nach Aussage des Verfassers entstand es auf Grund von
Erzählungen einer kaschubischen Hausangestellten seiner Eltern, die damals in
Danzig lebten.
Dass das „Kaschubische Weihnachtslied“ bereits früher eine Rolle
für das Volk der Kaschuben gespielt hat, ist von Ernst Seefried-Gulgowski in
dem Buch „Von einem unbekannten Volke in Deutschland“ (veröffentlicht 1911)
dokumentiert. Der hier genannte Text zeigt interessante Bezüge zum späteren
Gedicht von Werner Bergengruen. Allerdings wird hier durch den Wortlaut der
letzten Strophe dem „Kaschubischen Weihnachtslied“ eine besondere Wirkung
gegeben:

|
Sei uns
gegrüßet geliebter Jesu, unser von Ewigkeit ersehnter Herr.
Aus Kaschubien
zum Stalle eilen hurtig wir alle
und bis zur
Erde neigen die Stirne - und bis zur Erde neigen die Stirne.
|
Warum so arm
liegst du in der Krippe und nicht im Bettchen, wie es dir zukommt.
Im Stalle
geboren, in der Krippe gebettet.
Warum mit Ochsen
und nicht mit Herren - warum mit Ochsen und nicht mit Herren.
|
Wärst in
Kaschubien du uns geboren, wärest auf Heu von uns nicht gebettet.
Hättest ein
Strohsäckchen, darüber ein Bettchen,
und viele
Kissen gefüllt mit Daunen - und viele Kissen gefüllt mit Daunen.
|
Und auch dein
Kleidchen wär nicht so einfach. Aus grauem Fellchen ein reiches Mützchen.
Aus blauem
Tuche ein Röckchen und ein grünes Warb-Jöppchen,
dazu ein’
Netzgurt würd’ man dir geben - dazu ein’ Netzgurt würd’ man dir geben
|
Wärst in Kaschubien
du uns geboren, brauchtest dann niemals Hungersnot leiden.
Zu jeder
Tageszeit hättest Gebratenes,
zum
Butterbrödchen, wodki ein Gläschen - zum Butterbrödchen, wodki ein Gläschen.
|
Zu Mittag
hätt’st du Buchweizengrütze, mit gelber Butter reichlich begossen.
Saftiges
Gänsefleisch, mit Speck Kartoffelmus,
und Fleck mit
Ingwer nicht zu vergessen - und Fleck mit Ingwer nicht zu vergessen.
|
Und Wurst mit
Rührei gar fett gebraten, darnach der Liebling würd’ wohl geraten.
Zum Trinken
gäb man dir Tuchler- oder Berent-Bier.
Könntest dann
schwelgen in den Genüssen - könntest dann schwelgen in den Genüssen.
|
Zum Abendbrot
hätt’st du schmackhafte Flinzen und zarte Würstchen mitsamt Pieroggen.
Wruken mit
Hammelfleisch, Erbsen mit Speck gekocht,
und fette
Vöglein knusprig gebraten - und fette Vöglein knusprig gebraten.
|
Bei uns gibts
Wildbrett, Jesu, in Menge.
Wäre allzeit
für dich wohl bereitet, ganz junge Rebhühnchen und andre Vögelchen,
auch fette
Täubchen und Krammetsvögelchen - auch fette Täubchen und Krammetsvögelchen.
|
Dort hast du
allzeit Mangel gelitten, hier hätt’st du alles im Überfluß.
Beim Trinken
und Essen, Beim Spielen, Erzählen,
wäre beim
Amtmann dein Platz am Tische - wäre beim Amtmann dein Platz am Tische.
|
Doch dir
genügt schon der gute Wille, unsere Wünsche nimmst du als Gaben.
Die Herzen zum
Opfer bringen wir dem Schöpfer.
|
Verachte uns
nicht, obwohl wir arm sind. Verachte uns nicht, obwohl wir arm sind.
Biographie –
Werner Bergengruen
1892
Am 16.
September wird Werner Bergengruen im lettischen Riga als 2. Sohn eines Arztes
schwedischer Herkunft geboren.
Obwohl sich seine
Familie wegen der Russifizierungspolitik des Zarenreiches zur Ausreise
entschließt, bleibt Bergengruen zeitlebens der Landschaft und Kultur seiner Heimat
verbunden.
bis 1914
Bergengruen
besucht das Gymnasium in Lübeck, lebt seit 1909 in Marburg und studiert seit
1911 Theologie, Germanistik und Kunstgeschichte an den Universitäten Marburg,
München und Berlin, ohne einen Studienabschluss zu erwerben.
1914-1918
Kriegsfreiwilliger
auf deutscher Seite im Ersten Weltkrieg.
1919
Bergengruen tritt
der Baltischen Landeswehr bei, die in seiner Heimat gegen die Rote Armee
kämpft.
Er heiratet
Charlotte Hensel und lebt, von Unterbrechungen abgesehen, als freier
Schriftsteller in Berlin.
1922
Leiter der
Zeitschrift "Ost-Informationen" in Berlin.
1923
Bergengruens
literarisches Werk beginnt mit der Veröffentlichung des
abenteuerlich-romantischen Romans „Das Gesetz des Atum“, den er nicht wieder
auflegen ließ.
1926 folgt der
Roman „Das große Alkahest“ (seit 1938 „Der Starost“) , 1930 „Karl der Kühne“,
1931 „Der goldene Griffel“.
Erster Höhepunkt
im Gesamtwerk ist 1935 der verschlüsselte Zeitroman „Der Großtyrann und das
Gericht“, durch den er weithin bekannt geworden ist.
1925
Hauptschriftleiter
der "Baltischen Blätter".
seit 1927
Lebt er als freier
Schriftsteller in Berlin und München.
1933-1945
Dem
Nationalsozialismus steht Bergengruen vor allem wegen seiner christlich-humanen
Gesinnung ablehnend gegenüber.
Seine
regimekritischen Gedichte des Gedichtzyklus "Der ewige Kaiser" (1937)
gehen in Abschriften von Hand zu Hand.
1937 schließen ihn
die Nationalsozialisten wegen seines Romans "Der Großtyrann und das
Gericht" (1935) aus der Reichsschrifttumskammer mit der Begründung aus, er
sei nicht geeignet, "durch schriftstellerische Veröffentlichungen am
Aufbau der deutschen Kultur mitzuarbeiten". Es folgt das Verbot einiger
seiner Bücher sowie ein Rundfunk- und Vortragsverbot.
1936
Konversion zum
katholischen Glauben.
Er zieht sich aus
Berlin zurück, aus der Stadt, mit der ihn so viel verband, und geht nach Solln
in der Nähe von München, wo er dann durch einen Bombenangriff 1942 Wohnung und Habe verliert.
1937
Bergengruens bekannteste
Novelle "Die drei Falken" handelt vom eigensüchtigen Streit unter den
Erben eines Falkenmeister, wobei der Haupterbe aus Abscheu vor der Gier seiner
Geschwister einem wertvollen Falken die Freiheit schenkt.
1946
Lebt zunächst bei
Freunden in Zürich, 1948/49 in Rom. Veröffentlichung der Werke "Zauber und
Segenssprüche", "Lobgesang" und "Der hohe Sommer".
1951
Auszeichnung mit
dem Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig.
1952
Veröffentlichung
des Romans "Der letzte Rittmeister".
1958
Verleihung der
Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität München und des
Großkreuzes des Bundesverdienstordens: Wenig später wird er als Nachfolger
seines verstorbenen Freundes Reinhold Schneider Mitglied des Ordens "pour
le mérite"
1960
Veröffentlichung
der Erzählungen "Zorn, Zeit und Ewigkeit".
1964
4. September:
Werner Bergengruen stirbt in Baden-Baden.
|
