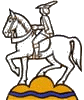
Gastronomisches
Groß-Hansdorf
Schmalenbeck
![]()
„Parkhotel
Manhagen“
1883 kaufte der Hamburger Kaufmann
Johann Dietrich Theodor Tietz den Manhagenwald. Nach seinem Tod 1898 verkauften
seine Erben den großen Grundbesitz, der mehrfach den Besitzer wechselte. 1929
kaufte die Stadt Hamburg das Gelände zurück und verpachtete den westlichen Teil
des Parkes mit Landhaus und See an den früheren Besitzer des ‚Parkhotels an der
Elbchaussee’, A.J.A. Möller, der in der Villa das weitbekannte ‚Hotel Manhagen’
einrichtete. 1978 wurde das Hotel abgerissen.
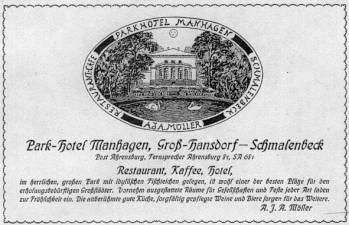 um 1935
um 1935
 um 1910
um 1910
um 1955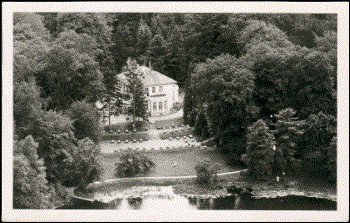
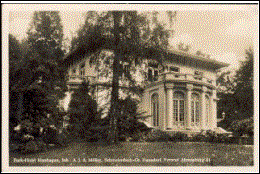
.
Hotel „Zum Hamburger Wald”
Am 15. April 1902 kaufte
sich der ehemalige Blankeneser Schiffkoch Hans Heinrich Jansen das an der
Sieker Landstraße (jetzt ‘Alte Landstraße’) gelegene Gewese ‘Hamburger Wald’.
Unter der Leitung von Jansen und seiner Frau Martha erlange das Hotel bald
große Beliebtheit. Schieß- und Spielstätten machten es zu einem beliebten
Ausflugsziel für Familien, Gesellschaften und Vereine. Nicht selten fanden hier
Feste mit bis zu 500 Personen statt.
Der große parkartige Garten
des Hotels reichte bis an den Schmalenbecker See. Für die Gäste hatte man am
Ufer eine Anlegestelle für Ruderboote gebaut. Sogar ein kleines Segelschiff aus
Eichenholz lag am Steg. Der See hatte damals ein bedeutend größeres Ausmaß als
heute. Durch den Hochbahnbau wurden die natürlichen Wasserläufe durchschnitten,
und er hat keinen Zulauf mehr.
1943 verkaufte die Witwe
Jansen an den Kaffehausbesitzer Mehrer. Von 1945 bis 1948 besetzten englische
Truppen das Haus. Der Gastwirtsbetrieb fand während dieser Zeit in einem
ausgebauten Stall statt. Die evangelische Kirche übernahm 1953 das Anwesen und
benutzte das frühere Hotel noch bis zu seinem Abriß 1977
1910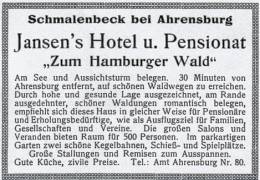
 1900
1900
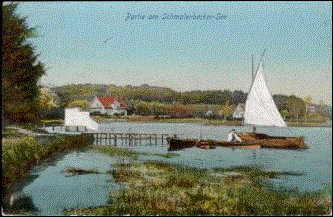
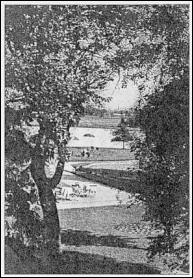

um 1935

.
„Restaurant
Mühlendamm“
Das ‚Restaurant Mühlendamm’ ist
die älteste Gastwirtschaft in Großhansdorf und Schmalenbeck. Ehemals Wohnhaus
der alten Wassermühle aus dem Jahre 1642, entstand daraus 1845 ein Gasthaus.
Carl-Friedrich Dunker kaufte es 1908 ohne Felder und ließ es renovieren und
vergrößern, indem er eine Veranda, Tanzsaal und Kegelbahn anbaute.
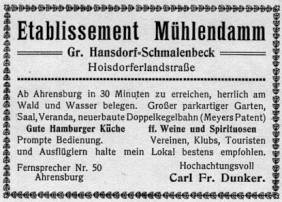 um 1910
um 1910 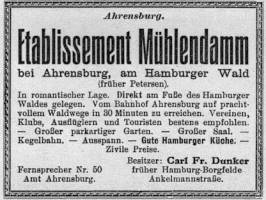
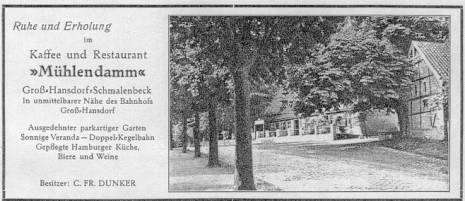
um 1935
 um 1960
um 1960
„Hotel Waldburg“
Inmitten der Hamburger
Waldungen, an der heutigen Straße Depenwisch, gründete Hermann Lampe 1871 sein ‚Hotel
und Logirhaus’ ‚Waldburg’. Es war ein zweistöckiger Holzbau mit Tanzsaal und
Doppelkegelbahn. Auch nach der Veräußerung im Jahre 1908 an den Besitzer von
Jäckbornshorst wurde die Gastwirtschaft in Pacht von Hamm weiterbetrieben. 1919
folgte Mohr als Pächter; noch im selben Jahr brannte die ‚Waldburg’ nieder. Die
Ställe und das Wirtschaftsgebäude blieben von den Flammen verschont. Wenige
Jahre später zerstörte ein weiteres Feuer auch das Logirhaus. Nicht lange nach
dem Brand verkaufte Adolf Wentzler 1919 das Grundstück an den Bankier Jordan,
der die Waldburg in den Jahren 1921/22 als schlichten Klinkerbau neu erstehen
ließ. Die zweite Waldburg pachtete nun der Hotelier A.J.A. Möller, welcher den
Betrieb 1931 in das später sehr geschätzte Parkhotel Manhagen verlegte.
In den vierziger Jahren zog
ein Altenheim ein. Von 1949 bis 1960 mietete die Landesversicherungsanstalt das
geräumige Gebäude, um ihre Kleinkinderstation aus dem großen Krankenhaus dahin
zu verlegen. Die letzten Besitzer ließen 1961 das Hauptgebäude abreißen. heute
steht ein großer Bungalow an dieser Stelle und wird privat bewohnt.
um 1915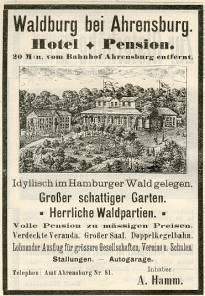
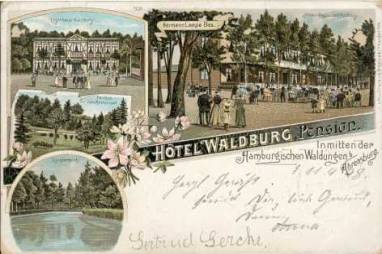
um 1898
um 1905 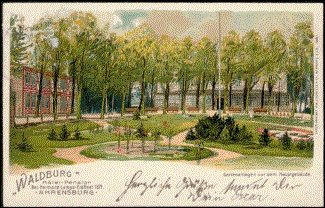
Hotel „Vier
Linden“
Nach zweijähriger Bauzeit
wurde am Wöhrendamm am 18. März 1905 das ‚Hotel Vierlinden’ eingeweiht. Sein Besitzer
Friedrich Steenbock hatte es nach den großen Bäumen vor dem Haus benannt. In
Hamburger Zeitungen priesen Annoncen Kegelbahn, Biergarten und den großen Saal
mit Bühne und Galerie für Veranstaltungen am Hansdorfer Wöhrendamm an. Es war
ein Hotel für gehobene Ansprüche. Das Haus besaß Gästezimmer, Eßzimmer, eine
Galerie und Vorsaal, der große Saal faßte vierhundert Personen.
Der Kriegsausbruch 1914
machte dem fröhlichen Treiben ein Ende. Die Kegelbahn wurde zum Quartier für
kriegsgefangene Russen, der große Saal Kornlager.
Nach dem Verkauf 1942 nutzte
man die Räume für gewerbliche Zwecke und Wohnungen. An das alten Lokal erinnert
nur noch die Eingangstür. Das Dach wurde abgetragen, die Form der Fenster
verändert und die Außenhaut mit Platten verkleidet.
1912
 1905
1905
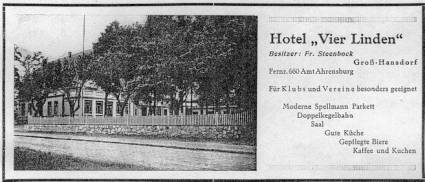 um 1935
um 1935
„Pension
Eilshorst“
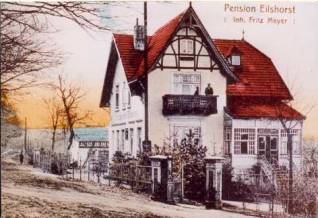

um 1905
„Gastwirthschaft am Hopfenbach“
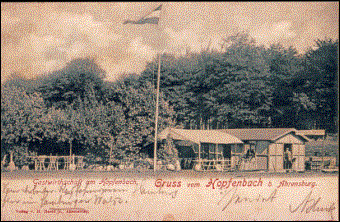

um
1900
„Bahnhofs-Restaurant
Groß Hansdorf“
Der zweite Sohn des
Dorfschmieds, der Mauerer Hermann Eckmann, errichtete 1903 dieses Haus ohne Anbau
am Eilbergweg. Später wurde es verkauft und durch An- und Umbauten zum
Restaurant verändert. Direkt an der Endstation der Walddörferbahn gelegen,
lockte der große Kaffeegarten viele durstige und müde Wanderer zum Ausruhen an.
Nach den Besitzern Schröp und Hamer übernahm Hubert Laumann, seit 1920 Polizist
in Groß-Hansdorf, 1932 das ‚Bahnhofs Restaurant’. 1962 verkaufte der Nachfolger
Pukies das Grundstück an den Apotheker Schilling, der hier bis 1983 die
Bahnhofsapotheke betrieb

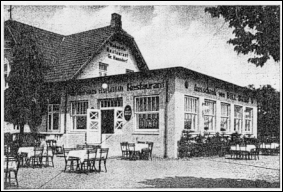 um 1935
um 1935 
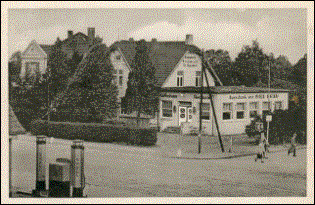
um 1950
.
„Paape’s Gasthof“
Die Gründung des Paapeschen
Dorfgasthofes geht auf das Jahr 1868 zurück. In dem kleinen Bauerndorf bildete
Paapes Gasthof mit einem Krämerladen und zeitweise auch einer Poststelle den
Mittelpunkt.
1895 baute Hans Paape unter
Mithilfe der Bauern einen Saal und ein Klubzimmer an. Wegen der wachsenden
Einwohnerzahl und des sich ausbreitenden Ausflugsverkehrs vergrößerte Carl
Paape seine Gastwirtschaft nochmals. Das Haus wurde in den Jahren 1903-1905 aufgestockt,
bekam einen Salon und eine Kegelbahn. Im Clubzimmer versammelte sich der
Männergesangverein, im Saal tanzte man beim Vogelschießen und anderen
dörflichen Festen.
Als das Kino immer mehr in
Mode kam, konnten sich die Groß-Hansdorfer bei Paape zu Filmvorführungen
treffen. Zum Bedauern der Besucher mußte das Kino wegen nicht ausreichender
Sicherheitsvorkehrungen in den fünfziger Jahren schließen. Der kleine
Krämerladen im linken Teil des Hauses wurde 1977 in den großen Anbau verlagert
und später zu einem großen Einkaufsmarkt ausgebaut. Der Dorfgasthof wechselte
indes auf die linke Seite und bestand dort als kleinere Gastwirtschaft weiter.
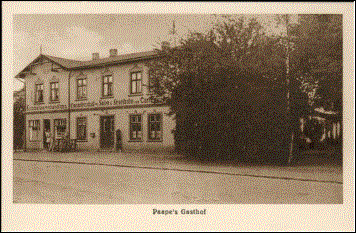 um 1910
um 1910
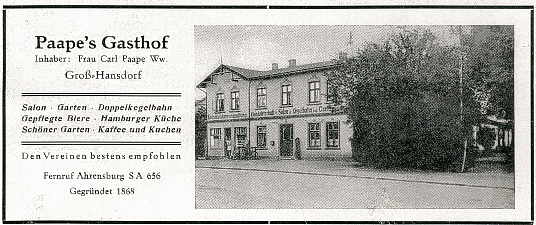
„Zum Landhaus“
Um 1900 stand eine alte Kate
am Wöhrendamm. Der Hausschlachter August Offen wohnte hier mit seiner Familie.
Sein Sohn Rudolf entschloß sich in den zwanziger Jahren, die väterliche Kate in
ein Restaurant umzubauen. Ausflügler und Besucher des nahen Krankenhauses
kehrten in dem gemütlichen Wirtsgarten gern zu einer kleinen Ruhepause ein.
1954 wurde der
Restaurationsbetrieb ‚Zum Landhaus’ aufgegeben. Danach nutzte die Familie Kiehr
die umgebauten Gasträume als Laden und Lager für Haushalts- und Eisenwaren. Es
wurden Haken, Ösen, Nägel und Schrauben verkauft, einzeln oder im Dutzend, in Tüten
und auch auf die Hand.

|
zurück zu NeueZeiten |
|
|
zurück
zur Startseite |